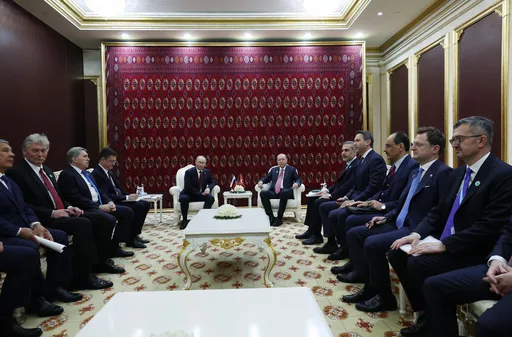Am 25. Februar 2021 erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass ArbeitgeberInnen das Tragen eines Kopftuchs am Arbeitsplatz untersagen können. Bereits im Jahr 2017 hieß es in einem Gutachten des EuGH, dass „größere religiöse Symbole“ wie z.B. das Kopftuch am Arbeitsplatz verboten werden können, wenn eine „konkrete Gefahr eines wirtschaftlichen Nachteils für den Arbeitgeber oder einen betroffenen Dritten“ besteht.
Kurz darauf, am 4. März 2021, folgte der Beschluss des NRW-Landtags über ein Verbot von religiösen Symbolen wie z.B. das Tragen eines Kopftuchs oder eines Kreuzes, wovon RichterInnen, StaatsanwältInnen und Justizbeschäftigte betroffen sind.
Die Rechtslage
Um mit der Rechtslage fortzufahren, muss erwähnt werden, dass der Staat in Artikel 4 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes den Individuen die Freiheit des Glaubens, des Gewissens sowie des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses gewährt. Qua Gesetz darf sich also jeder Mensch – somit auch muslimische Frauen – selbstbestimmt kleiden. Jedoch wird das muslimische Kopftuch oftmals als Antagonismus gegen die normativen Grundlagen europäischer Gesellschaften degradiert und marginalisiert. Es stellt sich die Frage, inwiefern eine solche „Befugnis“, die den ArbeitgeberInnen erteilt wird, die Partizipationsmöglichkeiten von Muslimas mit Kopftuch fördern kann, wenn gerechte Zugangsmöglichkeiten für alle BürgerInnen ein gemeinsames Ziel von postmigrantischen Gesellschaften sein soll.
Europäische Gesellschaften sind in den letzten Jahrzehnten von zunehmender religiöser und kultureller Pluralität geprägt, worauf sich sowohl Staaten als auch die Religionsgemeinschaften einstellen müssen. Die religiöse Vielfalt erfordert ein hohes Maß an diversitätssensiblen Maßnahmen und einen adäquaten Umgang mit der Wertevielfalt in europäischen Gesellschaften. Das Spektrum des religiösen Pluralismus beruht vor allem auf der Einwanderung von MuslimInnen, sodass in diesem Zusammenhang immer wieder Debatten und rechtliche Beschlüsse über das muslimische Leben aufkommen.
Studien über Diskriminierungen von MuslimInnen
In Deutschland müssen sich muslimische Frauen mit Kopftuch bei gleicher Qualifikation mindestens vier Mal häufiger bewerben, um eine Einladung für ein Bewerbungsgespräch zu bekommen, heißt es in der Studie „Discrimination against Female Migrants Wearing Headscarf“ der IZA aus dem Jahr 2016. Das aktuelle Infopapier (März 2021) „Antimuslimischer Rassismus in Deutschland. Zahlen und Fakten“ vom Mediendienst Integration zeigt, dass die gemeldeten Diskriminierungserfahrungen von MuslimInnen vor allem „bei der Arbeit“ verortet werden, gefolgt von privaten Dienstleistungen, Bildung, öffentlichem Raum und Gesundheits- und Sozialleistungen. Auffällig ist hierbei der Anteil der Frauen mit Diskriminierungserfahrungen, der deutlich höher als bei anderen Befragten liegt (Männer/keine Angabe).
Zu den weiteren interessanten Ergebnissen zählt die Aussage „Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land“, der 47% der Befragten zustimmten. Deutlich hervorgehoben wird in dem Infopapier, dass Frauen mit Kopftuch besonders viel Diskriminierung bei der Arbeit, bei Bewerbungsprozessen oder Kündigungen erfahren.
Die Ergebnisse der empirischen Studien zeigen, dass kopftuchtragende Musliminnen auf dem Arbeitsmarkt ohnehin diskriminiert werden und dass ein solcher Beschluss den Handlungsspielraum für Diskriminierung und Machtkonfiguration seitens der ArbeitgeberInnen erweitern würde.
So wie staatlich verordnete Kleiderordnungen und „Zwangsverschleierungen“ in autokratischen Ländern wie z.B. dem Iran, die doktrinär Frauenkörper bestimmen und Menschen entmündigen, zu verurteilen sind, so sind Verbote und „erzwungene Entschleierungen“ in demokratischen Staaten zu verurteilen, da beide dieselbe Wirkung haben, nämlich Fremdbestimmung und Bevormundung. Ähneln prohibitive Maßnahmen und Bevormundung durch Staat, ArbeitgeberInnen etc. nicht den Praktiken in autokratischen Systemen, die in unserer freiheitlich-liberalen Gesellschaft deplatziert sind?
Die Wirkung prohibitiver Maßnahmen
Zudem ist es kritisch zu betrachten, dass der Beschluss des EuGH nicht für alle religiöse Symbole gültig sein muss. Ein Beschluss, der zulässt, dass lediglich das Kopftuch untersagt werden kann und andere religiöse Symbole zulässt, gefährdet die Glaubwürdigkeit eines zur Neutralität verpflichteten Rechtssystems. Der Beschluss des NRW-Landtags umfasst zwar auch das Tragen eines Kreuzes, doch ist dies nicht mit dem Kopftuch zu vergleichen, da ein Kreuz auch getragen werden kann, ohne dass es gesehen wird.
Aus diesem Grund sind prohibitive Maßnahmen, die zudem rechtlich untermauert werden, problematisch zu sehen, denn sie beruhen auf einer angenommenen suggestiven Wirkung des Kopftuchs, darauf, dass es mit dem Prinzip der Neutralität inkompatibel sei. Es ist zutiefst diskriminierend und frauenfeindlich, Frauen im Namen der „unternehmerischen Freiheit“ vom Arbeitsmarkt auszuschließen.
Es stellt sich die Frage, wo die religiöse und kulturelle Pluralität der europäischen Einwanderungsgesellschaften besser vermittelt werden kann als am Arbeitsmarkt. Die Rechte der Minoritäten müssen per Gesetz geschützt werden, sodass sie gleichberechtigte Teilhabechancen in alle gesellschaftlichen Ebenen haben. Doch drohen solche Beschlüsse das Gegenteil zu bewirken, denn laut diesem Beschluss werden sich ArbeitgeberInnen nicht vor dem Antidiskriminierungsgesetz (AGG) verantworten müssen, sofern sie die Einstellung von Musliminnen aufgrund des Kopftuchs verwehren. Gleichbehandlung und Schutz der Rechte von Minoritäten durch politische Regulierungen sollten in postmigrantischen, pluralisierten Gesellschaften anders aussehen.