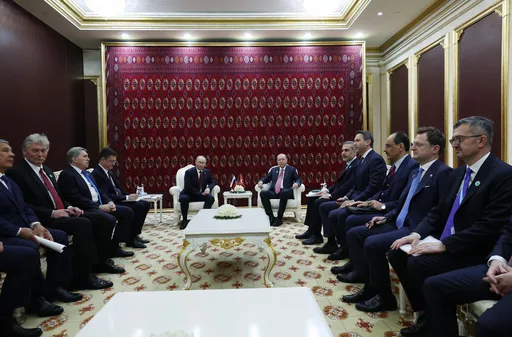„Als Frau wird man nicht geboren, zur Frau wird man gemacht“, sagte Simone de Beauvoir. Dieser Satz gilt als das Credo des Feminismus. In der postmigrantischen Gesellschaft wäre die dazu äquivalente Aussage: „Als der ‚Andere‘ wird man nicht geboren, zum ‚Anderen‘ wird man gemacht“.
Die zeitgenössische Identitätspolitik erkennt normativ weitgehend eines an: den Pluralismus innerhalb der Gesellschaft - dass heutige Gesellschaften aus Individuen und Gemeinschaften bestehen, die divergente Welt- und Selbstbilder und unterschiedliche Wertvorstellungen und Lebensweisen haben. Auch ist es positiv anzumerken, dass es nicht das Ziel ist, diese Differenzen aufzuheben und diese zu einer „Einheit“ amalgamiert werden, sondern partikulare Besonderheiten toleriert werden. Doch während dies als ein positiver Prozess innerhalb von postmigrantischen Gesellschaften angemerkt werden muss, bedarf es einer Reflexion bezüglich der etablierten dominanten Denkweise.
Die letzten Jahre sind von sozialen Bewegungen geprägt, die die Würde und Gleichberechtigung von marginalisierten Gruppen wie z.B. Frauen, ethnische Minoritäten, Homosexuellen und Flüchtlingen erzielen. In Deutschland ist dieser Prozess vor allem von der LGBTQI-Bewegung, der feministischen Bewegungen und der Me-Two-Debatte geprägt. Menschen, die ins gesellschaftliche Abseits gedrängt wurden, erheben ihre Stimmen, um als gleichwertige BürgerInnen wahrgenommen und behandelt zu werden. Sie erheben den Anspruch, gleiche Zugänge zu Ressourcen zu haben und gerechte Teilhabechancen zu erhalten. Sie stellen soziale Privilegien, kulturelle Dominanzverhältnisse und Deutungshoheiten in Frage. Dies ist nicht als „Opfernarrative“ zu deuten, wie es oft in der Identitätspolitikkritik gemacht wird, sondern als ein Zeichen von einem Selbstverständnis des Dazugehörens. Dieses Selbstverständnis wird zwar zum Teil von Diskriminierungserfahrungen in jedem Lebensbereich und von den Aussagen mancher PolitikerInnen infrage gestellt, doch es ist da - mehr denn je zuvor.
Inklusion statt Integration
Der Diskurs um Minoritäten wird stets von dem Begriff der Integration dominiert, doch diesen Prozess hat die postmigrantische Gesellschaft längst hinter sich: die Begriffe, die für die dritte und vierte Generation von Relevanz sein sollten, sind: Inklusion, gleichberechtigter Zugang zu den Ressourcen und Teilhabe.
Wer bin ich? Was macht mich aus? Wofür stehe ich? Diese Fragen sind wichtig bei der Identitätsfindung. Genauso wichtig ist das Gefühl von Anerkennung und Zugehörigkeit in der Gesellschaft, welches ein wichtiger Aspekt von Identität ist. Im eigenen Geburtsland der „Andere“ zu sein oder als „anders“ wahrgenommen zu werden, zerstört jede Selbstverständlichkeit und zwingt zur Reflexion über die Identität.
Kann Mann/Frau nicht gleichzeitig türkisch, arabisch etc. und deutsch sein, sich in beiden Ländern zu Hause fühlen oder mehrere Heimaten haben? Warum gibt es in dem dominanten Diskurs um die Bevölkerungsteile eine akkurate Trennung, die grob zwischen muslimischen People of Color (PoC) und „echten“ Deutschen unterscheidet und keinen Raum für die Selbstbestimmung und Individualität lässt? In Deutschland geboren und/oder aufgewachsene PoCs machen dieselben Erfahrungen bei der Identitätsfindung wie der Rest der Gesellschaft. Es ist ein komplexerer Prozess, doch das Ergebnis ist keinesfalls „brüchige Identitäten“, wie es oftmals suggeriert wird.
Identitätsdiskurse mit Fremdzuschreibungen
Identitätsdiskurse greifen nationalkodierte Deutungsmuster auf, bestätigen diese zum Teil und schaffen dabei dogmatische Lebensweisen und schreiben dominant-nationale Identitäten vor, ohne die Individualität zu beachten. Doch wie funktioniert die Identitätsfindung, wenn den PoCs ständig einige Attribute aberkannt und einige fremdzugeschrieben werden, wenn es eine never-ending Forderung über das Bekenntnis zum „Deutsch-Sein“ gibt, ohne dass es definiert wird. Und ja, es wird paradoxer: das undefinierte „Deutsch-Sein“ wird ihnen inständig aberkannt. Fragen wie „Was ist die deutsche Leitkultur?“ oder „Gehört der Islam zu Deutschland?“ sind längst démodé und irrelevant, doch sie schaffen es trotzdem, den Mainstreamdiskurs zu dominieren.
Das Interessante an dem dominanten Identitätsdiskurs ist, dass sich der Mainstream des Rechtspopulismus nach den Paradigmen der Identitätspolitik die Opfernarrative verwendet und den Schutz der nationalen Identität fordert. Diese Identität beinhaltet nicht nur „rassische“ oder religiöse Attribute, sondern richtet sich viel mehr an die Kultur. Auf der anderen Seite sind die Ausbreitung und das Wachsen sozialer Probleme und Ungleichheit populäre Aspekte, um die kulturellen und ethnischen Differenzen politisch aufzuladen und die Gesellschaft gegen Minoritäten zu mobilisieren. Seehofers Aussage „Migration ist die Mutter aller Probleme“ im Jahr 2018 - nach sechzig jähriger Migrationsgeschichte in Deutschland - ist ein bitteres Beispiel hierfür.
People of Color - zwischen den Stühlen?
Der wichtigste Schritt, um die Lebensrealität von PoCs zu verstehen, ist, sich von der Metapher „Menschen zwischen zwei Stühlen“ zu verabschieden. People of Color werden im öffentlichen Diskurs oft - um es mit der Sprache der Statistik zu beschreiben - als „Ausreißer“ dargestellt. So werden sie als Auslöser für „Kulturkonflikte“ suggeriert und sind mit ethnischen, kulturalisierenden und rassifizierenden Fremdzuschreibungen konfrontiert, durch die sie marginalisiert und „geändert“ werden.
Eine weitere Beschreibung neben der beliebten Metapher von Menschen zwischen zwei Stühlen ist auch die Aberkennung einer „gesunden“ Identität, da im Kontext von PoCs von Menschen mit „brüchigen Identitäten“ gesprochen wird. Die Annahme, die die politische Debatte prägt, ist, dass es sich um Menschen mit Orientierungsproblemen und defizitären Identitäten handelt.
Der kompensatorische und paternalistische Blick auf PoCs ist eine Folge der Migrationsgeschichte der Bundesrepublik, in der die Einwanderung inständig als „Integrations- und Sicherheitsproblem“ kontextualisiert wurde. Das heißt, der gesellschaftliche Umgang mit den MigrantInnen hat seinen Ursprung in der restriktiven politischen Haltung und der Integrationspolitik, die zum Teil eher wie eine „Desintegrationsstrategie“ wirkte, in dem sie die MigrantInnen in das gesellschaftliche Abseits drängte.
Folgen pseudo-wissenschaftlicher Studien
In der Studie „Ungenutzte Potentiale. Zur Lage der Integration in Deutschland“ des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung aus dem Jahr 2009, heißt es über die Integration von MigrantInnen: „Am besten integriert sind - kaum verwunderlich - die Personen aus den weiteren Ländern der EU-25“ (ohne Südeuropa).
Weiterhin heißt es: „Mit Abstand am schlechtesten integriert ist die Gruppe mit türkischem Hintergrund. Zwar sind die meisten schon lange im Land, aber ihre Herkunft oft aus wenig entwickelten Gebieten im Osten der Türkei, wirkt sich bis heute aus: Als einstige Gastarbeiter kamen sie häufig ohne Schul- oder Berufsabschluss, und auch die jüngere Generation lässt wenig Bildungsmotivation erkennen“.
Solche Aussagen als Ergebnisse von „wissenschaftlichen“ Studien sollten alarmierend sein, da sie rassistische Ressentiments und Stigmata bedienen. Während der Einschub „kaum verwunderlich“ die Selbstverständlichkeit einer erfolgreich gelungenen Integration von MigrantInnen aus europäischen Staaten suggeriert, stellt die Aussage „auch die jüngere Generation lässt keine Bildungsmotivation erkennen“ türkischstämmige MigrantInnen generalisierend und homogenisierend als bildungsfern und „unintegrierbar“ dar. Umso alarmierender ist die Tatsache, dass dies ein in der Gesellschaft weiterverbreiteter Wissensbestand ist, der zumeist unreflektiert hingenommen und somit zu einem Mainstream-Gedankengut wird.
Impliziter Rassismus in der Alltagsrealität
Der britische Soziologe und Kulturtheoretiker Stuart Hall definiert dies als „impliziten Rassismus“ und meint damit, dass rassistische Ressentiments zum Mainstream und zur Routine und zu einem selbstverständlichen Bestandteil des kollektiven Wissens werden. Auf der anderen Seite wirkt sich dieser implizite Rassismus in der Alltagsrealität von People of Color mit expliziten Fragen und Aussagen wie „Woher kommst du wirklich?“ und „Du sprichst aber gut Deutsch“ und der Forderung von kulturellen Bekenntnissen aus.
Eine andere Dimension von diesem impliziten Rassismus zeigt sich darin, wenn Schulen mit hohem Anteil an Schülern of Color als „Brennpunktschulen“ marginalisiert werden; Viertel in Großstädten, die mehrheitlich von PoCs bewohnt werden, als „no-go-areas“, Ghettos und „soziale Brennpunkte“ gelten. Konflikte an solchen Schulen und Vierteln sind nicht auszuschließen, wie in jeder anderen Schule und in jedem anderen Viertel, doch eine kategorische Marginalisierung, vor allem auch medial, sollte kritisch hinterfragt werden.
Denn die Lebensweise von PoCs wird als Kulturkonflikt verstanden und als solche präsentiert, wobei PoCs als desorientierte, undefinierte „Nicht-Ganz-Subjekte“ entmündigt werden. Dies definiert Hall als einen Versuch der Aufwertung der eigenen Identität durch die Abwertung der „Anderen“. Es findet eine Reduktion auf binäre ethnische Kategorien statt, ohne Rücksicht auf die Qualitäten und Fähigkeiten der PoCs zu nehmen.
Denn konträr zu dem Bild von „verwirrten“ und „orientierungslosen“ PoCs, das die Dominanzmedien erzeugen und das von der Mehrheitsgesellschaft unhinterfragt angenommen wird, sprechen People of Color mehrere Sprachen, verfügen über transnationale Netzwerke und interkulturelle Kompetenzen, bewegen sich gleichzeitig in unterschiedlichen Kulturen und entwickeln hybride Identitäten, die in der hegemonialen Deutung keine Anerkennung finden.
Die Lebenspraxis der People of Color ist weder als ein Abbild der Herkunftsländer der Eltern oder als Erweiterung der Herkunftskultur zu verstehen, sondern als eine neuentwickelte, divergente, lokale und authentische Lebensweise, die sich als Postulat festgesetzt hat, was nicht als „Desorientierung“, „Verwirrung“ oder „Kulturkonflikt“ degradiert werden darf.
Hybride Identität als globale Chance
Betont sei an dieser Stelle die Tatsache, dass Individuen der globalisierten Welt genau über die Eigenschaften verfügen sollten, die PoCs mitbringen: sich gleichzeitig in unterschiedlichen Kulturen bewegen, mehrere Sprachen sprechen und sich darin positionieren. Strenggenommen sind PoCs der heutigen globalisierten Welt und ihren Ansprüchen viel gerechter als jene, die den Pluralismus nicht anerkennen und ihn nicht leben.
An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob diese fehlende Anerkennung auch der Fall wäre, wenn es sich um Menschen handeln würde, die gleichzeitig Französisch und Deutsch sprechen und sich gleichzeitig in Frankreich und in Deutschland beheimatet fühlen – anstatt Türkisch und Deutsch, wie es im Status Quo der Fall ist. Der Mainstreamdiskurs, der die divergenten Welt- und Selbstbilder von PoCs als desorientiert und „brüchig“ postuliert, schafft es nicht, über konventionelle Identitäts- und Zugehörigkeitskategorien hinauszudenken und marginalisiert somit eine Bevölkerungsgruppe, die stetig wächst.
People of Color in Deutschland können sich mit über ethnische und nationale Grenzen hinausgehende, gleichzeitig Lokalität und Globalität vereinenden „multiple Kulturen“ identifizieren und mehrere „Heimaten“ haben, indem sie ihre transkulturelle Alltagspraxis entwerfen und sich darin entfalten – und dies bedarf einer Anerkennung und darf nicht degradiert werden. Transnationale soziale Netzwerke und Bindungen auf weltgesellschaftlicher Basis sind die neuen Qualifikationen in globalisierten, kosmopolitischen Gesellschaften und dies wird kaum thematisiert, vielmehr wird der Diskurs um die vermeintliche Alltagsrealität von People of Color durch ethnisierende Fremdzuschreibungen beschrieben und marginalisiert.
Da der schwierigste Schritt getan ist und Deutschland seit einigen Jahren nun endlich akzeptiert hat, dass es ein Einwanderungsland ist, ist es höchste Zeit für einen Paradigmenwechsel, bei dem diese Werte nicht nur normativ anerkannt werden, um die Migrationsgesellschaft realitätsgerecht zu gestalten: Das bedeutet, dass die partikularen, individuellen Bedürfnisse und Lebensweisen nicht nur deskriptiv, sondern auch praktisch anerkannt und unterstützt werden.