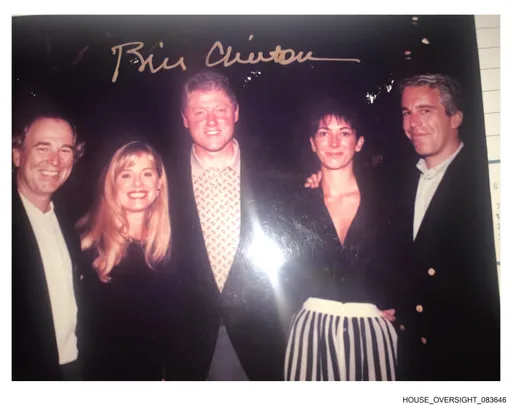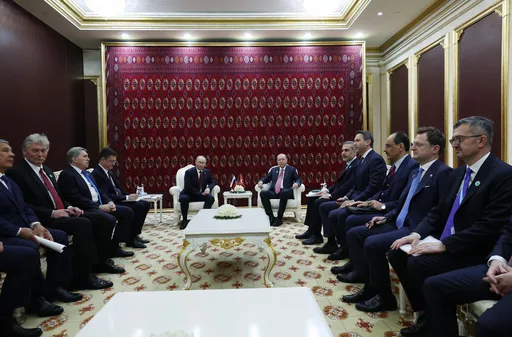Die Wahlen zum Europäischen Parlament (EP) 2024 sind entschieden. Im Vorfeld gab es düstere Umfragen, die einen deutlichen Rechtsruck prophezeiten. Dieser ist aber ausgeblieben.
Werden die Wahlergebnisse zum Europäischen Parlament (EP) analysiert, so lässt sich festhalten: Beide Rechtsfraktionen zusammen (Europäische Konservative und Reformer (EKR) sowie Identität und Demokratie (ID) konnten ihre gemeinsamen Sitze ausbauen, von 118 auf 131. Aber nicht so dramatisch wie ursprünglich angenommen: Dies entspricht einem erweiterten gemeinsamen Sitzanteil von 18,2 %. In verschiedenen nationalen Parlamenten haben Rechtspopulisten durchaus höhere Sitzanteile. Auf EP-Ebene fällt die Zersplitterung der Rechtsparteien in zwei Fraktionen auf. Hier drückt sich aus, dass es unter Europas Rechtsparteien keinen Konsens darüber gibt, wie mit Putin umgegangen werden soll. Während ID gegenüber Russland einen weicheren Kurs fährt, ist die ERK-Fraktion deutlich kritischer zu Putin-Russland eingestellt. Die christdemokratisch-konservative Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) blieb jedoch die stärkste Kraft im EP, konnte sogar ihre Sitze von 176 auf 186 ausbauen und hält zurzeit einen Sitzanteil von 25,83 %. Verluste fuhren hingegen liberale, linke und grüne Parteien ein.
Insgesamt muss festgehalten werden, dass die konkreten Länderergebnisse zur EP-Wahl sehr unterschiedlich ausfielen. So konnte der liberale Block „Renew Europe“ stimmenstärkste Partei in Dänemark, den Niederlanden und Tschechien werden. In Deutschland, Spanien und anderen Ländern führt der christdemokratisch-konservative EVP-Block. In nur drei Ländern in Westeuropa lagen die Rechtspopulisten vorne: in Italien die EKR und in Frankreich und Österreich die ID-Fraktion.
Ergebnisinterpretation für Deutschland
Zu Jahresbeginn wurden der Rechtsaußen-Partei Alternative für Deutschland (AfD) noch Ergebnisse jenseits der 20 Prozent vorhergesagt. Es kam dann anders, und die AfD landete nur noch auf 15,9 % der Stimmen, hochgerechnet für ganz Deutschland. wenn es auch der zweite Platz war. Die AfD geriet in Turbulenzen, nachdem ihr Spitzenkandidat Maximilian Krah in einem Interview mit der italienischen Zeitung „La Repubblica“ am 18. Mai behauptete, nicht jeder SS-Mann sei notwendigerweise ein Verbrecher gewesen: „Ich werde nie sagen, dass jeder, der eine SS-Uniform trug, automatisch ein Verbrecher war.“ Die AfD-Spitze verhängte daraufhin ein Auftrittsverbot gegen Krah. Die AfD schloss Krah auch aus ihrer EP-Delegation aus. Aber der Schaden war bereits entstanden. Auch auf Betreiben der französischen Rechtspopulisten RN wurde die AfD aus der europäischen Rechtsfraktion „Identität und Demokratie“ ausgeschlossen. Trotz des Ausschlusses von Krah will die ID-Fraktion die AfD vorerst nicht wieder aufnehmen. Die österreichische FPÖ stimmte nur für den Ausschluss Krahs, aber nicht der gesamten AfD-Fraktion. In den alten Bundesländern im Westen Deutschlands blieb die AfD durchwegs deutlich unter 20 %, hingegen in den neuen Bundesländern im Osten des Landes stieg die AfD durchgängig zur stimmenstärksten Partei auf, manchmal sogar mit mehr als 30 %. Dies verweist auf eine deutliche politische Spaltung Deutschlands zwischen West und Ost. Während die Schutzmauer „gegen Rechts“ im Westen Deutschlands funktioniert, könnte die AfD im Osten Deutschlands ihre Wählerbasis noch merklich ausdehnen. Gregor Gysi von der „Linken“ etwa meint, dass im Wiedervereinigungsprozess vielleicht einzelne Fehler gemacht wurden.
Die christdemokratische Opposition von CDU/CSU hielt ihre dominante Position, baute ihren Wähleranteil sogar von 28,9 auf 30 % aus. Hingegen alle Koalitionsparteien der regierenden „Ampel“ – SPD, Grüne und FDP – verloren, die Grünen stürzten sogar dramatisch von 20,5 auf 11,9 % ab. Für die bundesdeutsche Regierung war es eine „Denkzettelwahl“, wobei der sozialdemokratische Kanzler Olaf Scholz Rufen nach Neuwahlen eine deutliche Absage erteilte. Trotzdem ist die Situation für die deutsche Ampelkoalition brisant, denn spätestens im Herbst 2025 muss die nächste Bundestagswahl stattfinden. CDU/CSU befinden sich in einer komfortablen Ausgangsposition. Aussichten auf eine zweite Amtszeit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben sich durch diesen Doppelsieg von CDU/CSU national und der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament ebenfalls deutlich verbessert. Vieles deutet auf ein „reloaded“ von „von der Leyen 2.0“ hin.
Ergebnisinterpretation für Österreich
Der rechtspopulistischen FPÖ wurden für die EP-Wahl noch um die 30 % prognostiziert. Diese Prognose trat so nicht ein. Zwar wurde die FPÖ stärkste Partei, aber mit 25,4 % lag sie nur noch knapp vor der zweitgereihten christdemokratisch-konservativen ÖVP (24,5 %), und bereits danach positionierte sich die sozialdemokratische SPÖ (23,2 %). Die nächsten Nationalratswahlen in Österreich finden bereits diesen Herbst am 29. September statt. Umfragen sehen auch für dort die FPÖ mit fast 30 % der Stimmen voran. Die Ergebnisse der EP-Wahl scheinen aber wieder aufzuschnüren, dass es bereits fix ist, dass auch bei der kommenden Nationalratswahl die FPÖ den ersten Platz belegt. Alternativ könnte es noch ein Duell zwischen FPÖ und ÖVP um Platz eins werden, und selbst die SPÖ kann aufholen.
Ergebnisinterpretation für Frankreich
Die EP-Wahl ergab für Frankreich eines der „rechtesten“ Ergebnisse in Europa überhaupt. Der rechtspopulistische Rassemblement National (RN) mit Ex-Parteichefin Marine Le Pen katapultierte sich von 23,3 auf 31,4 % der Stimmen und behauptete damit klar seine Erstplatzierung. Die Rechtsaußen-Partei Reconquête erhielt 5,5 % der Stimmen, womit Frankreichs Rechtsblock einen Wähleranteil von insgesamt 36,9 % mobilisierte. Gleichzeitig halbierte sich der Stimmenanteil der liberalen Bürgerbewegung auf 14,6 %, der entscheidenden politischen Stütze für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Wahlbeteiligung lag bei niedrigen 51,5 %. Noch am Wahlsonntag rief Macron parlamentarische Neuwahlen aus, mit einer ersten Runde am 30. Juni und einer zweiten Runde am 7. Juli.
Für die Öffentlichkeit war Macrons Entscheidung eine große Überraschung, aber es gibt Berichte, dass sich eine interne Gruppe im Elysee-Palast damit schon länger auseinandersetzte. Über diese Strategie möchte Macron die Rechtspopulisten ausmanövrieren, indem er auf eine Mobilisierung jenseits von rechts, aber auch jenseits von links hofft. Hier schwebt Macron die Bildung neuer Allianzen vor. Wie er sagt, möchte er ein Zusammengehen der Gemäßigten gegen die „extremen Ränder“. Nach konventioneller Logik gibt es drei mögliche Ausgänge: (1) Macron gewinnt eine bürgerliche Mehrheit in der Mitte zurück; (2) der rechtspopulistische RN gewinnt eine absolute Mehrheit; (3) oder es gibt überhaupt keine klaren Mehrheiten im neuen Parlament. Im letzteren Fall würden drei ähnlich große Blöcke entstehen, und zwar das liberale Präsidentenlager, das links-grüne Lager und der Block der Rechtspopulisten, was wieder zu Formen einer „Cohabitation“ überleiten könnte . Eine aktuelle Prognose sagt voraus, dass der Rechtsblock im nächsten französischen Parlament zwar die stärkste Fraktion bilden wird, aber die absolute Mandatsmehrheit verfehlt. Die Notwendigkeit zur Bündnisbildung im französischen Mehrheitswahlrecht könnte für den RN eine zu große Hürde aufbauen.
Schafft der RN doch eine Mehrheit, so würde der nächste Regierungschef möglicherweise Jordan Bardella heißen, ein rechter „Shootingstar“, der bereits mit 16 der Vorgängerorganisation Front National beitrat und sich moderner sozialer Medien wie Tik Tok bedient. Bardella wurde 1995 geboren, und es wird gesagt, dass er zumindest teilweise einer Familie mit Migrationshintergrund entstammt und sein Vater in Algerien zur Welt kam.
Trotzdem soll Macrons strategischer Masterplan nicht unterschätzt werden. Wahrscheinlich geht es ohnehin mehr um Positionierungen für die nächste französische Präsidentschaftswahl im Jahr 2027.