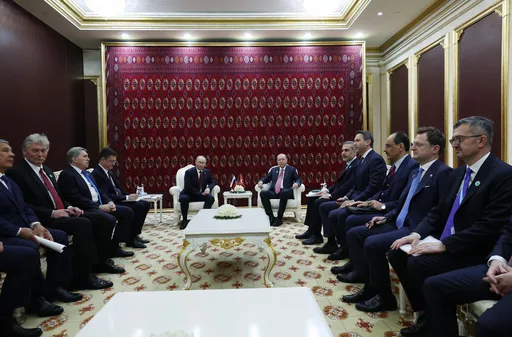von Ali Özkök & Burcu Karaaslan
Elif Şenel wurde 1978 in Köln geboren, hat unter anderem Politische Wissenschaft und Geschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn studiert und ist seit 2001 in unterschiedlichen Formaten des Journalismus tätig.
Im Jahr 2010 hat sie erstmals die Sendung „Vor Ort“ auf Phoenix moderiert. Şenel ist zudem mehrfache Trägerin des Axel-Springer-Preises für junge Journalisten.
Eines der Projekte, für die sie sich seit Jahren engagiert, ist das des Vereins „Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland“ zur Errichtung eines zentralen Migrationsmuseums.: kurz DOMiD.
Anlässlich des 60. Jahrestages des Anwerbeabkommens der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei hat sie mit TRT Deutsch über Ziel und Stand dieses Projekts gesprochen.
Im Jahr 2007 hatten sich die Projekte DOMiT und „Migrationsmuseum in Deutschland e.V.“ zum Verein „Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland“ zusammengeschlossen. Ziel beider Initiativen war die Errichtung eines zentralen Migrationsmuseums. Wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Bilanz des Vorhabens und wie viele ähnliche Projekte gibt es, die ein ähnliches Ziel verfolgen?Unsere Gründerinnen und Gründer haben sich vor 30 Jahren zusammengeschlossen und es war von Anfang an das Ziel, dass wir dieses Migrationsmuseum haben möchten. Auf dem Weg bis hierhin wurden unheimlich viele Projekte umgesetzt, wie beispielsweise Ausstellungen mit großen namhaften Museen. Der Ansatz, der auch die anderen Museen immer sehr beeindruckt hat, ist, dass wir ein Verein sind, der von Migrantinnen und Migranten gegründet wurde, bei dem im Mittelpunkt stand: „Wir wollen unsere Geschichte erzählen.“
Diese eigene Erzählung findet zu wenig statt und das wollen wir jetzt zusammentragen, so dass alle mitbekommen, dass wir ein Stück weit das Gedächtnis der Migrationsgesellschaft sind. Insofern hat es zwar einerseits lange gedauert, aber der Weg war wichtig und wir haben große und bedeutsame Schritte auf den Weg dorthin gemacht. Es gibt nichts Vergleichbares in Deutschland, denn das ist eine Grassroots-Bewegung.
Welche sind die bedeutsamsten Ziele des Museumsprojekts für die kommenden Jahre? Sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet.Also das bedeutendste Ziel ist natürlich die Museumseröffnung. Wir planen diese vor Ende 2025. Das ist schon sehr bald. Die Mittel sind in die Haushalte eingestellt. Wir sind jetzt mittendrin in den Arbeiten und es gibt einen Plan, wie das Ganze jetzt langsam in Fahrt kommt. Es ist auch ein längerer bürokratischer Prozess. Aber wir sind eigentlich sehr zufrieden mit dem, was wir schaffen und das ist ein enormer Schritt.
Uns ist total wichtig, dass dieser Gedanke, dass Menschen ihre eigene Geschichte in dieses Museum einbringen können, erhalten bleibt. Das von uns geplante Haus wird ein sogenanntes „partizipatives“ Museum sein: Sie und ich, wir können dort hingehen und am Ende kann Ihre Geschichte auch in diesem Museum Einzug finden. Und das ist das Besondere, denn das ist das „Haus der Einwanderungsgesellschaft“. Wir formen das gemeinsam und darum geht es.
Welche Erfahrungen haben Sie aus Ihrer bisherigen Karriere als Journalistin mit Migrationshintergrund mitgenommen? Ist es mittlerweile alltäglicher als früher, dass auch Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte in deutschen Medien Akzeptanz finden?
Es hat sich sehr viel getan. Andererseits glaube ich: so ganz Normalität ist es noch nicht. Es gibt unterschiedliche strukturelle Hindernisse, aber es passiert auch total viel. Ich erinnere mich daran, als Dunja Hayali irgendwann in den 1990er Jahren plötzlich im Fernsehen war und mein Vater zu mir gesagt hat: „Da ist ein Ausländer im Fernsehen, da ist ein Ausländer.“ Und er war so fasziniert und gerührt und es hat ihn so bewegt. Das passiert heute viel mehr. Deswegen ist das auch im Journalismus so unheimlich wichtig, dass mehr Menschen mit einer Migrationsgeschichte auf die Bildschirme kommen. Und dieses Bewusstsein, das gibt es auch immer mehr. Das ist aber ein längerer Prozess und heute passiert ernsthaft auch eine Bemühung darum.
Also das war früher, glaube ich, nicht so präsent. Aber zunehmend wird unserer Gesellschaft klarer, dass eben, wenn wir 25 Prozent der Menschen in Deutschland mit Migrationsgeschichte haben, dass sie abgebildet werden und ihre Geschichten erzählt werden müssen. Ebenso wichtig: dass sie natürlich besseren Zugang haben möglicherweise als Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben, weil sie vielleicht einfach anders sozialisiert worden sind, weil sie andere Kontakte haben, weil sie andere Zugänge haben, weil sie andere Sprachen sprechen. Und dafür ist es total wichtig, um diese Gesellschaft eben auch in ihrer Gänze abbilden zu können.
Menschen mit Migrationshintergrund bringen in der Regel auch eine Mehrsprachigkeit mit. Wird das von der Gesellschaft inzwischen als Gewinn wahrgenommen?
Das hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt, dass man das als Fähigkeit wahrgenommen hat und nicht als Hindernis; dass man auch sagt, man muss eine Sprache erst mal gut beherrschen, um daraufhin aufbauend eine zweite Sprache zu beherrschen. Ich habe zu Hause Türkisch gesprochen, bis zum Kindergarten habe ich kein Wort Deutsch gesprochen und es ist mir gelungen, Deutsch zu sprechen, Deutsch zu lernen – das hat mit Anerkennung und Wertschätzung zu tun.
Es stellt auch einen Prozess dar, der unfassbar lange für diejenigen unter uns dauert, die ungeduldig sind. Das ist die schlechte Nachricht. Aber es ist auch tatsächlich etwas passiert, das muss man auch sehen.
Im Jahr 1990 wurde das Vorgängerprojekt DOMiT als Einrichtung mit dem Fokus auf türkische Einwanderer gegründet. Mittlerweile hat es sich das DOMiD zum Ziel gesetzt, für alle migrantischen Communitys zum Ort zu werden, an dem ihre Geschichten erzählt werden. Ist es aus Ihrer Sicht gelungen, die vielen zum Teil recht unterschiedlichen Communitys, die zum Teil auch in unterschiedlichen Jahrzehnten ihre neue Heimat hier gefunden hatten, unter einen Hut zu bringen?
Die Menschen sind einfach unterschiedlich. Es gibt gemeinsame Migrationserfahrungen und das ist etwas, was sie verbindet. Ich spreche von bestimmten Gefühlen, die man vielleicht hat, auch noch mal anders je nachdem, ob man geflüchtet ist oder ob man selber emigriert ist, ins Exil gegangen ist. Das sind alles ganz unterschiedliche Beweggründe.
Dieses Museum ist, und das ist mir auch noch mal ganz wichtig, nicht nur ausgerichtet an Menschen mit Migrationsgeschichte, im Gegenteil, es ist ein Ort, der Brücken bildet. Also jemand, der keine eigene Einwanderungsbiographie hat und dort hinein geht, der wird dort Verbindungen finden und sich wiedererkennen und auch Dinge erkennen, die in allen Seelen schlagen, also die in allen Seelen zu spüren sind. Und das wird eine Nähe erzeugen. Es ist das Haus der Einwanderungsgesellschaft. Wir verstehen Deutschland als ein Einwanderungsland. Einwanderung ist Normalität und wir müssen zusehen, dass wir sie gestalten. Und das wird in diesem Haus sichtbar sein, in diesem Migrationsmuseum im Haus der Einwanderungsgesellschaft.
Manche Einwanderergruppen scheinen anerkannter zu sein als andere. Wieso ist das so?
Ich glaube, es ist wichtig, keine Konkurrenz unter den Zuwanderungscommunitys, wenn man den Begriff benutzen möchte, aufzumachen.Was man sich, glaube ich, bewusst machen muss, ist, dass sich die Wahrnehmung von Einwanderern und Einwandererinnen zeitlich verändert hat. Es gab eine Zeit, als die Türkinnen und Türken nach Deutschland gekommen sind, wo sie als „Preußen des Orients“ betrachtet wurden. Das waren die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man sich vorstellen konnte. Da konnte man sie gar nicht genug loben. So gibt es zum Beispiel auch, was die Wahrnehmung der Religion beispielsweise anbelangt, ein Foto bei uns im Archiv, wo Muslime mit ihren Gebetsteppichen im Kölner Dom gebetet haben. Das ist schon eine ganze Weile her. Heute undenkbar.