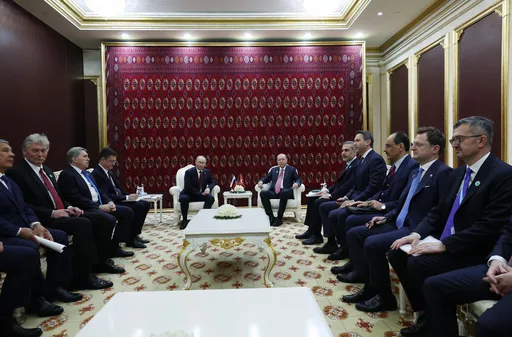Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, geht davon aus, dass Russland angesichts seines Angriffskriegs in der Ukraine die Spionage in Deutschland verstärkt. „In Deutschland gibt es, wie in anderen europäischen Staaten auch, seit dem Kalten Krieg anhaltende russische Spionageaktivitäten“, sagte Schindler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Samstagsausgaben). Schon länger sei eine Zunahme der russischen Nachrichtendienst-Aktivitäten zu beobachten.
Anzahl russischer Spionage in Deutschland unbekannt„Wenn kriegerische Auseinandersetzungen mit wirtschaftlichen Sanktionen verbunden sind, liegt es auf der Hand, dass auch die nachrichtendienstlichen Aktivitäten zunehmen“, erklärte Schindler. "Wir stehen sicherlich noch nicht am Ende dieser Entwicklung."
Seriöse Aussagen über die Zahl russischer Spione in Deutschland ließen sich nicht treffen. Außer den Russen selbst wisse das niemand genau. „Die Spione, die dem Bundesamt und den Landesämtern für Verfassungsschutz bekannt sind, bilden nur die Spitze des Eisbergs.“ Die Bundesregierung hatte kürzlich 40 russische Diplomaten aus Deutschland ausgewiesen, denen sie Spionage-Tätigkeit vorwirft. Ähnlich waren zuvor auch mehrere andere EU-Staaten verfahren.
„Jeder erkannte Spion ist ein Pluspunkt“Schindler sieht das Vorgehen jedoch skeptisch: „Jeder erkannte Spion ist ein Pluspunkt für die deutschen Sicherheitsbehörden.“ Man könne diesen Spion beobachten, sein Bewegungsprofil nachvollziehen und überwachen, mit wem er kommuniziert. „Wenn man den jetzt nach Hause schickt und dafür neue kommen, steht man wieder ganz am Anfang: Man weiß dann nicht, ob ein neuer Kultur-Attaché auch ein Spion, oder ein gewöhnlicher Diplomat ist“, erklärte Schindler.
Für die Spionageabwehr sei es deshalb kein Vorteil, erkannte Nachrichtendienstler auszuweisen. Nichtsdestotrotz könne es politisch manchmal erforderlich sein, solche Zeichen zu setzen.