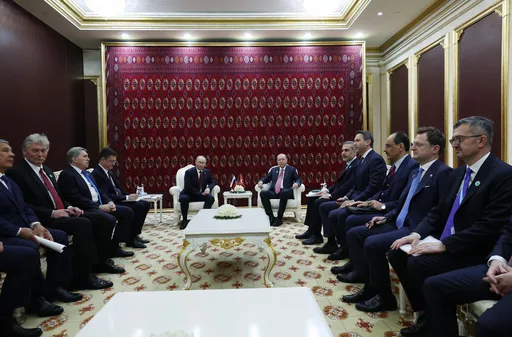Aus der Ferne mutet es an wie ein Spektakel. Der amtierende Bundespräsident, ursprünglich ein Kandidat und langjähriger Vorsitzender der Grünen in Österreich, verkörpert vieles. Als er 2016 erstmals antrat, konnte kaum jemand erahnen, dass damit ein für die Zweite Republik Jahrzehnte kennzeichnendes Strukturmerkmal zu Ende gehen würde. Zum einen war erstmals kein Kandidat der ehemaligen Großparteien mehr im Spiel, als es in die zweite Runde ging. Die beiden Vertreter der ehemaligen Großparteien kamen jeweils auf knapp über elf Prozentpunkte. Im Duell standen auch Kandidaten jener zwei Parteien, die seit den 1980er Jahren die Großkoalition immer mehr ausgehöhlt hatten: Die rechte FPÖ hier und die Grünen dort.
Das meistverbreitete Gefühl in Österreich nach dem Wahlabend war vermutlich die Genugtuung, dass es nicht wie zuletzt 2016 zu einer Stichwahl gekommen war. Neben dem amtierenden Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen standen weitere fünf Kandidaten zur Auswahl, die ein recht eigenartiges Bild abgaben. Besonders relevant: Weder die Sozialdemokratie noch die christdemokratische Volkspartei hatten einen Kandidaten aufgestellt. Die Parlamentsparteien SPÖ und NEOS unterstützen im Wesentlichen den Amtsinhaber. Während SPÖ und NEOS als derzeitige Oppositionsparteien mit diesem Zug v.a. Geld sparen konnten, war es beim derzeitigen Umfragetief der regierenden Volkspartei nach dem Abgang des skandalgetriebenen Sebastian Kurz vermutlich vernünftig, nicht noch eine weitere Wahlschlappe einzufahren. Dieser für die drei Parteien wohl Sinn machende Zug hat aber einen für die politische Debatte negativen Nebeneffekt.
Er gab jenen Kandidaten eine große Bühne, die mit recht jenseitigen Positionen die politische Debatte des Wahlkampfes prägten. Während Van der Bellen 56,2 Prozent erhielt und damit eine Wahlwiederholung vermied, brachte es der rechte Kandidat der FPÖ, Walter Rosenkranz, mit 17,9 Prozent auf den zweiten Platz. Das Wahlergebnis kann unterschiedlich gelesen werden. Einerseits gab es in der Geschichte der Zweiten Republik keine Wiederwahl, in welcher der amtierende Präsident so wenig Unterstützung erhielt. Andererseits ist mit Van der Bellen ein in vielen Augen gesellschaftlich liberaler Kandidat im Rennen gewesen, was, will man Dominik Wlazny (Vorsitzender der lokalen Wiener Bierpartei, der vor allem dadurch auffiel, dass er als einziger Kandidat nicht sofort die Bundesregierung entlassen würde) mit seinen 8,4 % dazuzählen, insgesamt eine Unterstützung von 65 % bedeutet.
Auf der anderen Seite steht eine Unterstützung von rechten Kandidaten unterschiedlicher Schattierung von fast 32 %, rechnet man zu Walter Rosenkranz mit seinen fast 18 % noch Tassilo Wallentin (8,3 %), der schon einmal auf einem FPÖ-Ticket in den Verfassungsgerichtshof hätte geschickt werden sollen, was aber vom derzeitigen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen verhindert wurde. Und dann ist da noch der ehemalige Generalsekretär des von Jörg Haider nach seiner Abspaltung von der FPÖ gegründeten BZÖ, Gerhard Grosz (5,5 %).
So wurde das Rennen im Wesentlichen entlang einer Trennlinie gezogen: Sechs sich volksnah inszenierende Kandidaten stellten sich gegen das vermeintliche „System“ (Van der Bellen). Wobei die sich dem Volke nahestehend inszenierenden Kandidaten wie Grosz und vor allem Rosenkranz mit ihrem Hintergrund in politischen Parteien und Wallentin als Journalist der Kronen Zeitung und ebenso wie Heinrich Staudinger aus dem Berufsstamm der Rechtsanwälte stammend alles andere als fern von diesem sogenannten System waren. Aber ihre Ansagen – inklusive Staudinger – präsentierten im Wesentlichen ein identitäres Demokratieverständnis, wonach eine abgehobene Politklasse von dem Volke, repräsentiert durch den direkt gewählten Bundespräsidenten, zurechtgewiesen werden sollte. Der Wahlkampf wurde zu einem Paradebeispiel des Erodierens gewohnter Maßstäbe. Nicht zuletzt wegen der Abstinenz eines sozial- und christdemokratischen Kandidaten wurde das Feld der öffentlichen Debatten vollständig dem Populismus überlassen.
Van der Bellen hatte dem als Spaßkandidaten heruntergespielten Bierpartei-Vorsitzenden und einzigen Kandidaten, der sozialpolitisch nicht rechts stand, im Wesentlichen ein Argument entgegenzusetzen: Jede Stimme für ihn war eine verlorene Stimme, die eine Stichwahl mit sich bringen würde.
Der Wahlkampf hat vor allem neurechten Positionen, Anti-Establishment-Positionen und autoritären Politikforderungen die Bühne gegeben. Ob die ehemaligen Großparteien dies noch einmal geschehen lassen wollen?