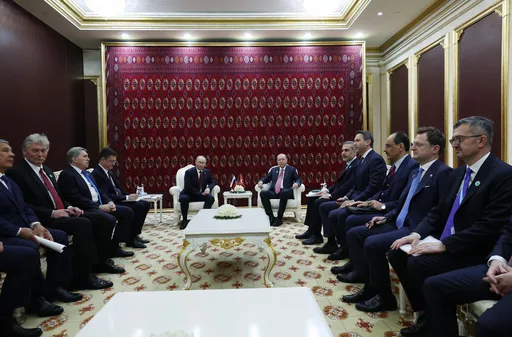Jüdische und muslimische Studierende erleben gleichermaßen auf dem Campus immer wieder Diskriminierung in unterschiedlichster Form. Auf einer Online-Veranstaltung des Dialogprojekts „Schalom Aleikum“ des Zentralrats der Juden in Deutschland haben zwei zwei Studierende am Mittwoch erläutert, wie der Umgang mit Anfeindungen aussehen kann. „Islamiq“ berichtete zuerst darüber.
Stereotype Darstellungen und Reduktion auf Identitäten
„Eine Universität ist nicht frei von Diskriminierung“, sagte Bilal Torun von der Universität Hildesheim. Das geschehe im persönlichen Umfeld. Bei Lehrveranstaltungen werde in Stereotypen über Muslime und die arabische Welt gesprochen und entsprechende Vorstellungen verbreitet. Dozenten schafften damit Bilder, die oft nicht der Realität entsprächen. Dabei sei die muslimische Gemeinschaft in sich sehr vielfältig.
Ähnliches habe auch Sana Kisilis von der Humboldt-Universität zu Berlin für die jüdische Gemeinschaft erfahren. Zudem berichtet sie, dass Menschen oft auf ihre jeweilige Identität reduziert würden. So würden Juden beispielsweise regelmäßig gebeten, zum Nahostkonflikt Stellung zu nehmen. Dabei lebten sie in Deutschland und hätten vielleicht gar keine starken Bindungen an Israel.
Kisilis zufolge fehle der Mehrheitsgesellschaft oft das Bewusstsein dafür, dass Gemeinschaften nicht homogen sind. Es gäbe säkulare und religiöse Juden, deren Lebensweisen sich voneinander unterscheiden würden. Das sei anmaßend und daher fordere Kisilis, sich selbstbewusst von Fremdzuschreibungen zu lösen.
Kooperation zur Verteidigung gemeinsamer Interessen sinnvoll
Zudem hätten Juden und Muslime viele Gemeinsamkeiten und gemeinsame Überzeugungen, Anliegen und Interessen. Diese beträfen Themen wie Beschneidungen von Jungen, Gebetsmöglichkeiten während der Arbeitszeit, das rituelle Schlachten von Tieren oder das Bedecken des Haars bei religiösen Frauen. Daher warb Kisilis für intensivere „Allianzen“. Wenn die Communities kooperierten, um Probleme anzupacken, könnten sie mehr bewirken.
Torun sieht in der deutschen Gesellschaft viel Rassismus und fordert Lösungen. Man könne nicht alles als Einzelfälle behandeln. Auch müsse der Perspektive von Angehörigen einer Minderheit mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Speziell an Universitäten halte er Antidiskriminierungsstellen für hilfreich. Auch müsse in der Ausbildung von Lehrkräften stärker für diese Themen sensibilisiert werden.
Beide Studenten hätten jeweils eine muslimische und eine jüdische Hochschulgruppe mitgegründet. Sie dienen als Anlaufstellen für Betroffene, der Vernetzung, der Repräsentanz nach außen und dem Austausch.